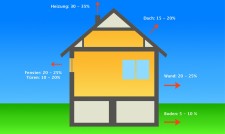Trinkwasser ist des Menschen wichtigstes Lebensmittel und Grundvoraussetzung zum Überleben für das Wohlbefinden und die Vitalität. Während in Deutschland und anderen fortgeschrittenen Ländern Wasser problemlos und zu moderaten Preisen erhältlich ist, sieht es in anderen Ländern weniger gut aus. Aber auch in der Bundesrepublik zahlt man mittlerweile immer mehr für das Wasser. Das Thema Wasseraufbereitung Zuhause gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Wie gesund ist unser Trinkwasser?
Jeder Deutsche verbraucht durchschnittlich 128 Liter Trinkwasser am Tag. Erstaunlich, dass wir davon nur etwa fünf Liter fürs Kochen und Trinken nutzen. Dennoch muss sich jeder Mensch auf die Qualität des Wassers verlassen können. In der Regel ist das auch problemlos möglich, schließlich werden Rohre und Leitungen täglich überprüft und der Schadstoffgehalt sowie die Bakterienbelastung laufend überwacht. Das Problem geht in den meisten Fällen auch nicht von den Wasserversorgern aus, schließlich sind sie für das, was im heimischen Keller zugeht, nicht verantwortlich. Alte, verschmutzte Rohre und Leitungen können das Wasser mit Schwermetallen belasten.
Mögliche Gefahren im Trinkwasser
Das sogenannte Stagnationswasser, also Wasser, das mehrere Stunden in den Leitungen gestanden hat. Hier können sich unter Umständen Schadstoffe wie Kupfer, welches in Hausinstallationen am häufigsten genutzt wird, anreichern. Zwar ist Kupfer ein lebenswichtiges Spurenelement, in hohen Dosierungen kann es allerdings gefährlich werden, gerade für Kleinkinder und Säuglinge. Die Kupferaufnahme über lange Zeit kann zu schweren Leberschäden führen. Auch neue Kupferrohre können problematisch sein, da sich hier noch keine Schutzschicht gebildet hat. Besitzt das Wasser einen hohen Säure-Wert, kann sich das Kupfer im Wasser lösen. Der noch tolerable Grenzwert liegt bei zwei Milligramm je Liter.
Neben Leitungen können auch Armaturen die Ursache für Schwermetallbelastung im Trinkwasser sein. Wasser, dass sich in verchromten Armaturen ansammelt, kann hohe Konzentrationen von Nickel besitzen. Für immerhin ein Sechstel der Bevölkerung führt Nickel zu allergischen Reaktionen. Die Ursache sind Darmbeschwerden und um schlimmsten Fall sogar Hirnschäden. So hohe Konzentrationen sind allerdings die Ausnahme. Der Grenzwert für Nickel liegt übrigens bei 20 Mikrogramm je Liter.
Tipps für eine gute Wasserqualität
- Stagnationswasser vermeiden: Den Weg vom Wasserversorger bis zum eigenen Wasserhahn sollte das Trinkwasser immer möglichst schnell zurücklegen. Fließt das Wasser über längere Zeit nicht, „stagniert“ es. Dieses Stagnieren ist mit einem abgelaufenen Verfallsdatum von Lebensmitteln zu vergleichen. Laut dem Umweltbundesamt sollte man Trinkwasser, welches mehr als vier Stunden stagniert hat, nicht zur Zubereitung von Getränken oder Speisen nutzen. Frisches Wasser ist daran zu erkennen, dass es kühler aus der Leitung kommt.
- Planung & Wartung: Beim Neubau sollten Installationen, die erst später zum Einsatz kommen, nicht mit Wasser gefüllt werden. Leitungen, die selten zum Einsatz kommen, verbindet man mit verbrauchsintensiven Endpunkten wie Spül- oder Waschmaschinen. Für Trinkwasser-Installationen kommen folgende Werkstoffe zum Einsatz:
- Kupfer
- Edelstahl
- verzinkter Stahl
- Kunststoffe und Verbundwerkstoffe
- Allergiker aufgepasst: Gerade Allergiker müssen darauf achten, welche Leitungen im eigenen Haus verbaut sind. In einigen Regionen der Bundesrepublik sind noch Bleirohre zu finden. Diese sind für das Trinkwasser besonders schädlich. Mieter sollten sich beim Vermieter oder einem SHK-Fachmann erkundigen, wie es mit der Installation aussieht.
- Trinkwasser untersuchen lassen: Mithilfe einer fachgerechten Analytik und Probenahme können Sie feststellen, ob die Qualität des Trinkwassers in Ordnung ist. Jedes Bundesland besitzt akkreditierte Untersuchungsstellen, die an dieser Stelle helfen können.
- Wasserfilter: Wenn es Probleme mit dem Trinkwasser gibt, können zum Beispiel Wasserfilter (Osmoseanlage) zur Wasseraufbereitung eingebaut werden. Für die Verwendung von einem Wasserbehandler ist darauf zu achten, dass er anerkannten Technikregeln entspricht. Hinweise liefern die beiden Prüfzeichen „DVGW“ oder „DIN/DVGW“ (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.). Es gibt allerdings auch Geräte ohne Prüfzeichen, die den Regeln entsprechen.
- Neuinstallation: Bei Neuinstallationen sollte ein Fachmann ran. Längst nicht jedes Material eignet sich für Wasser. Und welches Material geeignet ist, hängt wiederum mit der Wasserzusammensetzung zusammen. Der PH-Wert sowie der Gehalt und die Härte organischer Stoffe spielen eine große Rolle.
Artikelbild: © Alexander Hoffmann / Shutterstock