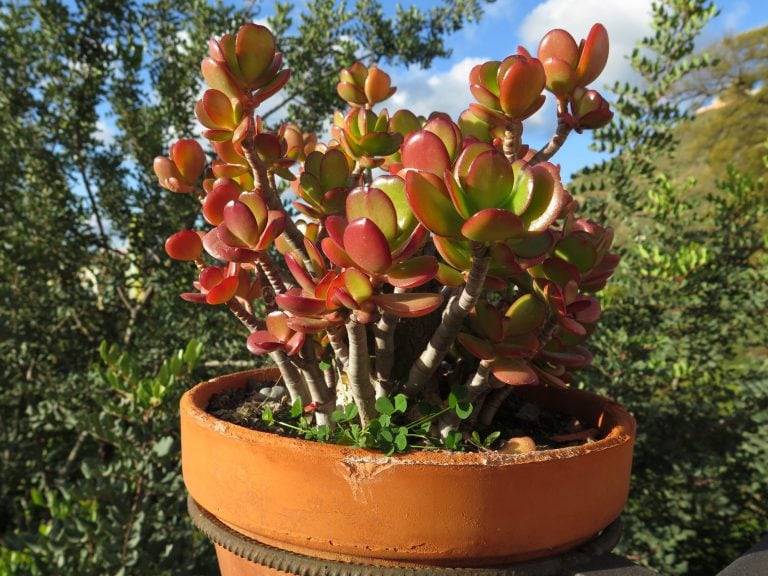Geschossflächenzahl (GFZ) einfach erklärt

Was ist die GFZ und rechtliche Grundlage (BauNVO §20)
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind – sie steuert die Bebauungsdichte eines Grundstücks. Praktisch heißt das: Mit GFZ 1,0 darfst du so viel Geschossfläche errichten, wie dein Grundstück groß ist; bei GFZ 2,0 darfst du das Doppelte. Diese Kennzahl ist ein zentrales Instrument der Bauleitplanung und bestimmt maßgeblich, wie intensiv ein Grundstück vertikal ausgenutzt werden darf.
Rechtsgrundlage ist § 20 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Dort ist geregelt, wie die GFZ festgesetzt wird und was als Geschossfläche anzusetzen ist. Die BauNVO wirkt zusammen mit Landesbauordnungen (Definitionen zu Vollgeschossen) und örtlichen Satzungen. Entscheidend ist immer der Bebauungsplan (B‑Plan) mit seinen Text- und Planfestsetzungen; was dort konkret zur GFZ steht, geht über allgemeine Annahmen. Fehlt ein B‑Plan, greifen die Grundsätze des § 34 BauGB (Einfügung in die nähere Umgebung) oder § 35 BauGB (Außenbereich), ergänzt durch landesrechtliche Bestimmungen.
Wichtig zu verstehen: Die GFZ regelt nicht alles. Sie ist Teil eines Ensembles aus GRZ (Grundflächenzahl), maximaler Gebäudehöhe, Zahl der Vollgeschosse, Baugrenzen, Abstandsflächen und oft auch Stellplatzsatzungen. Erst im Zusammenspiel entsteht ein baurechtlich tragfähiges Konzept. Du brauchst also mehr als nur die GFZ, um dein Vorhaben sicher planen zu können.
Formel und Schritt-für-Schritt-Berechnung mit Beispielen
Die Formel ist einfach: GFZ = Summe der Geschossflächen aller maßgeblichen Vollgeschosse ÷ Grundstücksfläche. Umgekehrt ergibt GFZ × Grundstücksfläche die zulässige Geschossfläche. Dennoch passieren Kalkulationsfehler, weil Details übersehen werden.
- Schritt 1: Bestimme die Grundstücksfläche. Verwende die amtliche Kataster- oder Vermessungsfläche. Bei Teilflächen (z. B. nach Abmarkung) zählt die bereits bereinigte Grundstücksgröße.
- Schritt 2: Prüfe, welche Geschosse als Vollgeschoss gelten. Die Definition „Vollgeschoss“ kommt aus der jeweiligen Landesbauordnung (Höhe, Anrechnung, Dach- und Staffelgeschosse). Nur die Flächen von Vollgeschossen zählen in die GFZ.
- Schritt 3: Summiere die Geschossflächen. Gemeint sind die Grundflächen der Vollgeschosse gemessen nach Außenmaßen der umschließenden Wände (Brutto). Spezielle Ausschlüsse (z. B. Balkone) stehen im B‑Plan oder ergeben sich aus der BauNVO.
- Schritt 4: Rechne die zulässige Geschossfläche aus. GFZ × Grundstücksfläche = maximal zulässige Geschossfläche. Die geplante Summe deiner Vollgeschossflächen darf diesen Wert nicht überschreiten.
- Schritt 5: Plausibilitätscheck mit GRZ und Baugrenzen. Selbst wenn die GFZ Spielraum lässt, können GRZ, Baugrenzen, Abstandsflächen oder die zulässige Gebäudehöhe den realisierbaren Umfang begrenzen.
- Schritt 6: Beispiel 1. Grundstück: 600 m², GFZ: 1,0. Zulässige Geschossfläche: 600 m². Planst du drei Vollgeschosse, darf die durchschnittliche Geschossfläche pro Vollgeschoss maximal ca. 200 m² betragen (sofern GRZ, Baugrenzen und Abstandsflächen das hergeben).
- Schritt 7: Beispiel 2. Grundstück: 800 m², GFZ: 1,2. Zulässige Geschossfläche: 960 m². Bei zwei Vollgeschossen sind das im Mittel 480 m² je Vollgeschoss. Wird ein drittes Vollgeschoss (Staffel) nur teilweise angerechnet, kann die Verteilung angepasst werden – Beachte die Vollgeschoss-Definition.
- Schritt 8: Umkehrrechnung. Geplante Summe Geschossflächen 720 m² auf 600 m² Grundstück ergibt eine rechnerische GFZ von 1,2. Ist im B‑Plan nur 1,0 festgesetzt, brauchst du eine Befreiung nach § 31 BauGB – mit Begründung und Risiko.
In der Praxis lohnt es sich, eine einfache Tabellenkalkulation zu führen. Eine Spalte je Vollgeschoss (Ist/Plan), eine Summenspalte und der GFZ‑Faktor – so siehst du sofort, ob du im Korridor bleibst.
Was zählt zur Geschossfläche (Vollgeschosse, Staffelgeschosse, Ausnahmen)
Kernfrage: Was gilt als Vollgeschoss? Die Landesbauordnung definiert das. Typisch ist eine Mindesthöhe (z. B. über 2,30 m im Mittel) und bei Dachgeschossen zusätzlich eine Mindestanteilsfläche unter ausreichender Höhe. Dachgeschosse können Vollgeschosse sein, wenn diese Kriterien erfüllt sind; sind sie zu niedrig oder zu klein, gelten sie nicht als Vollgeschoss.
Staffelgeschosse werden je nach Landesrecht und B‑Plan teilweise oder vollständig als Vollgeschoss angerechnet. Mancher B‑Plan erlaubt Staffelgeschosse „zurückgesetzt“ mit geringerer Grundfläche, um die städtebauliche Wirkung abzumildern. Prüfe im Textteil des B‑Plans, ob Sonderregeln existieren, z. B. maximale Staffelgeschossfläche in Prozent der darunterliegenden Geschossfläche.
Kellerflächen werden in der Regel nicht auf die GFZ angerechnet, weil Keller meist nicht als Vollgeschoss gelten. Ausnahmen sind selten, können aber vorkommen, wenn ein Untergeschoss teilweise aus dem Gelände herausragt und vollgeschossig wird. Achte hier auf die Geländedefinition im Baurecht (natürliches vs. geplantes Gelände).
Balkone, Loggien und Terrassen zählen meist nicht zur Geschossfläche, weil sie keine umschlossenen Flächen sind. Dennoch gibt es B‑Pläne, die bestimmte Vor- oder Rücksprünge regeln oder bei Überdachungen Besonderheiten vorsehen. Wintergärten sind in der Regel enclosed und können damit anrechenbar sein. Gleiches gilt für Aufzugsschächte und Treppenhäuser: Sie sind Teil des Vollgeschosses und finden sich in der Brutto-Geschossfläche wieder.
Garagen, Carports und Nebenanlagen werden oft gesondert geregelt. Für die GFZ zählen sie häufig nicht, für die GRZ oder Nebenanlagenregelungen jedoch sehr wohl. Lies deshalb unbedingt die textlichen Festsetzungen: Dort stehen Ausnahmen, Abzugsflächen und Höchstgrenzen, die deine Ausnutzung maßgeblich beeinflussen.
Kurz: Wenn es um die GFZ geht, gilt „Text vor Bauchgefühl“. Was zählt, definiert der B‑Plan gemeinsam mit BauNVO und Bauordnung – und nicht die allgemeine Lebenserfahrung.
GFZ vs GRZ vs BMZ – Unterschiede einfach erklärt
GRZ (Grundflächenzahl) und GFZ (Geschossflächenzahl) sind Geschwister, aber keine Zwillinge. Die GRZ sagt, wie viel Prozent deiner Grundstücksfläche du baulich überbauen darfst – eine horizontale Betrachtung. Die GFZ sagt, wie viel Geschossfläche im Ganzen zulässig ist – eine vertikale Betrachtung. Beide steuern also die Dichte, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Ein Beispiel macht es greifbar: Grundstück 500 m², GRZ 0,4, GFZ 1,2. Du darfst maximal 200 m² Grundfläche überbauen (GRZ), aber insgesamt 600 m² Geschossfläche realisieren (GFZ). Das deutet auf etwa drei Vollgeschosse à 200 m² hin. Wenn die maximale Gebäudehöhe oder Zahl der Vollgeschosse eingeschränkt ist (z. B. zwei), musst du die Verteilung anders denken oder akzeptieren, dass die formale GFZ nicht voll ausgeschöpft werden kann.
BMZ (Baumassenzahl) ist in manchen Baugebieten, insbesondere gewerblichen, relevant. Sie setzt das zulässige Bauvolumen (Kubatur) ins Verhältnis zur Grundstücksfläche. Während GFZ in m² rechnet, kalkuliert die BMZ mit Kubikmetern umbautem Raum. Die BMZ wirkt oft, wenn städtebaulich Raumkanten oder Höhenprofile wesentliche Ziele sind. In Wohngebieten ist BMZ seltener, aber füllt in Sonderfällen Lücken, die GFZ/GRZ nicht ausreichend präzise steuern.
Merke dir: GRZ begrenzt die Grundfläche, GFZ die gesamte Geschossfläche, BMZ das Volumen. Erst zusammen mit Baugrenzen, Abstandsflächen und Höhen ergibt sich dein nutzbares Baufeld.
Wo finde ich den GFZ-Wert (Bebauungsplan, Bauamt, Flächennutzungsplan)
Die erste Adresse ist der Bebauungsplan der Gemeinde. Viele Kommunen stellen B‑Pläne online in Geoportalen bereit. Dort findest du Planzeichnungen mit Legenden (GFZ, GRZ, Geschosszahl) und eine Textsatzung mit Detailregeln und Ausnahmen. Wenn es mehrere Fassungen oder Änderungsbebauungspläne gibt, gilt die jüngste, konsolidierte Variante – frag im Zweifel beim Bauamt nach.
Gibt es keinen rechtskräftigen B‑Plan, greift § 34 BauGB (Innenbereich). Dann muss sich dein Vorhaben nach Art und Maß der Nutzung in die nähere Umgebung einfügen. In der Praxis bedeutet das: Du orientierst dich an den Nachbargebäuden (Höhen, Geschosse, Dichten), was implizit eine „faktische GFZ“ ergibt. Verbindliche Zahlen fehlen dann, aber eine Bauvoranfrage kann die Zulässigkeit klären.
Der Flächennutzungsplan (FNP) gibt nur die grobe städtebauliche Entwicklung wieder und ist nicht parzellenscharf verbindlich. Er hilft, das städtebauliche Leitbild zu verstehen (z. B. Wohnbaufläche, Mischgebiet, Gewerbe), ersetzt aber keinen B‑Plan. Bei Unsicherheit: Ein Termin mit dem Bauamt, Akteneinsicht und – wenn es ernst wird – eine Bauvoranfrage liefern Verlässlichkeit.
Zusätzlich lohnt der Blick in örtliche Bauvorschriften, Gestaltungssatzungen oder Stellplatzsatzungen. Sie beschränken zwar nicht direkt die GFZ, können aber durch Stellplatznachweise, Dachformen oder Materialvorgaben die faktische Ausnutzbarkeit beeinflussen.
Einfluss der GFZ auf Immobilienwert, Rendite und Städtebau
Eine höhere GFZ steigert in der Regel das Entwicklungspotenzial eines Grundstücks, weil mehr Fläche erstellt und vermietet oder verkauft werden kann. In der Restwert- oder Residualwertlogik der Projektentwicklung transformiert zusätzliche Geschossfläche sich direkt in höheren Bodenwert – sofern sie wirtschaftlich gebaut und vermarktet werden kann. Banken sehen in einer höheren GFZ oft eine stärkere Besicherung, solange der Markt die Flächen nachfragt.
Für die Rendite zählt neben der absoluten Fläche die Flächenqualität. Ein hoher GFZ-Wert, der nur über ungünstige Grundrisse, dunkle Innenzonen oder teure Tiefgaragen erreichbar ist, frisst die Marge auf. Ein gut ausbalanciertes Verhältnis von GFZ, GRZ, Gebäudehöhe, Erschließungskern und Stellplatzkonzept macht die Ausnutzung erst wirtschaftlich.
Städtebaulich wirkt die GFZ in mehrere Richtungen: Dichte schafft Nähe, kurze Wege und urbane Vielfalt, kann aber bei Übermaß Aufenthaltsqualität, Belichtung und Mikroklima beeinträchtigen. Kommunen verknüpfen daher GFZ-Festsetzungen zunehmend mit Klimaanpassung: Dachbegrünung, Retentionsdächer, entsiegelte Höfe, Baumpflanzungen und versickerungsfähige Beläge. Das Ziel ist eine Dichte, die klimafit ist – gut entwässert, beschattet und mit Kühlung durch Verdunstung. In Verhandlungen kann die Zusage solcher Maßnahmen helfen, geforderte Dichten zu erreichen, ohne die Umweltziele zu verfehlen.
Kurz: Die GFZ ist ein mächtiger Werthebel – aber nur zusammen mit Architektur, Technik und Freiraumplanung wird daraus ein gutes Projekt.
Häufige Fehler bei der Berechnung und wie Sie sie vermeiden
Ein klassischer Fehler ist die Verwechslung von Netto- mit Bruttoflächen. Die GFZ bezieht sich auf die Brutto-Grundflächen der Vollgeschosse nach Außenmaßen – nicht auf vermietbare Flächen. Wer Nettoflächen aufsummiert, unterschätzt die GFZ‑Auslastung massiv.
Zweitens werden Balkone, Loggien und Terrassen oft fälschlich mitgerechnet. Sie sind meist nicht anrechenbar, während Treppenhäuser, Aufzüge und Technikflächen innerhalb der Vollgeschosse sehr wohl zählen. Prüfe die textlichen Festsetzungen, bevor du Flächen streichst oder addierst.
Drittens gibt es bei Dach- und Staffelgeschossen regelmäßig Fehldeutungen. Ein Dachgeschoss ist nicht automatisch ein Vollgeschoss. Es braucht die bauordnungsrechtlichen Mindesthöhen und Flächenanteile. Eine Staffelung, die zu groß ausfällt, kann plötzlich vollgeschossig werden – und deine GFZ sprengen.
Viertens: GRZ, Höhe und Abstandsflächen werden gerne zu spät geprüft. Du kannst theoretisch eine GFZ von 1,6 haben und praktisch nur 1,2 nutzen, weil die GRZ oder Baugrenzen ein schmales Baufeld erzwingen. Deshalb immer den Dreiklang GFZ–GRZ–Geometrie prüfen.
Fünftens: Fehlende Berücksichtigung örtlicher Satzungen (z. B. Stellplätze). Wenn 1 Stellplatz je 30 m² Wohnen gefordert ist, diktiert das rasch eine Tiefgarage, die Kosten und Machbarkeit prägt. Auch das kann die theoretisch mögliche GFZ relativieren.
Sechstens: Unklare Planstände. Es gibt Änderungs- oder Ergänzungsbebauungspläne, die einzelne Paragrafen überschreiben. Wer nur die Planzeichnung sieht und die Textfestsetzungen nicht liest, kalkuliert ins Blaue.
Die Gegenmittel sind simpel: sauber definieren, belastbar messen, frühzeitig mit dem Bauamt sprechen, und bei kniffligen Gebäudetypologien einen Architekten hinzuziehen.
Praktische Optimierungsstrategien für Bauherren und Investoren
Beginne mit einem Massestudium: Einfache 3D-Boxen entlang der Baugrenzen zeigen schnell, wie viel GFZ geometrisch „hineinpasst“. Plane die Erschließung schlank: Ein kompakter Treppenhauskern reduziert „tote“ Flächen und erhöht die nutzbare Quote je Vollgeschoss. Entzerrte Erschließungen kosten dagegen wertvolle GFZ.
Nutze Staffelgeschosse bewusst. Ein leicht zurückgesetztes Staffelgeschoss mit guter Belichtung bringt wertvolle Fläche, ohne die städtebauliche Wirkung zu überziehen. Achte auf die Vollgeschoss-Kriterien deiner Landesbauordnung, damit das Staffelgeschoss nicht ungewollt als Vollgeschoss zählt.
Setze auf modulare Raster. Wiederholbare Achsmaße vereinfachen Konstruktion und Haustechnik. So erreichst du bei gleicher GFZ geringere Baukosten pro m² und stärkst die Wirtschaftlichkeit.
Stellplatzkonzepte sind Hebel. Mobilitätskonzepte, Carsharing-Stellplätze oder Reduktionen nach Stellplatzsatzung können eine teure Tiefgarage vermeiden oder verkleinern. Das entlastet das Budget und lässt mehr der zulässigen GFZ in wertige Nutzfläche fließen.
Klimaanpassung als Deal Maker: Retentionsdächer, Dach- und Fassadenbegrünung, verschattete Höfe und Versickerungsflächen verbessern Mikroklima und Akzeptanz – und können politisch helfen, Befreiungen zu begründen. In städtebaulichen Verträgen lassen sich solche Qualitäten rechtssicher fixieren.
Früh mit dem Bauamt sprechen. Wer erläutert, wie ein Konzept Belichtung, Freiraum und Nachbarschaft respektiert, baut Vertrauen auf. Verbindet man hohe GFZ mit guter Architektur, werden Befreiungen nach § 31 BauGB eher als vertretbar gesehen.
Digitale Tools nutzen. GIS-Portale, einfache Volumenmodelle (SketchUp, Blender) und Flächentabellen schaffen Transparenz über „was geht“. Eine Massstudie in zwei Stunden spart oft Wochen späterer Korrekturen.
Checkliste vor Grundstückskauf
- Bebauungsplan und Textfestsetzungen vollständig einsehen, inkl. Änderungspläne und Legenden zu GFZ/GRZ/Höhen.
- Landesbauordnung zum Vollgeschoss-Begriff prüfen; Dach-/Staffelgeschosse gezielt verifizieren.
- Grundstücksfläche amtlich bestätigen; Teilflächen, Baulasten, Dienstbarkeiten (z. B. Leitungsrechte) klären.
- Baugrenzen, Abstandsflächen, Grenzabstände und mögliche Bauverbote (Leitungen, Bäume) kartieren.
- Stellplatzsatzung und Erschließungssituation (Zufahrt, Feuerwehr) auf Machbarkeit und Kosten prüfen.
- Nachbarschaftsanalyse (§ 34 BauGB) bei fehlendem B‑Plan durchführen; Höhen und Dichten dokumentieren.
- Klima- und Entwässerungsanforderungen (Versickerung, Retention, Begrünung) und Bodenverhältnisse (Tragfähigkeit) prüfen.
- Frühgespräch mit dem Bauamt vereinbaren; bei Unklarheit eine Bauvoranfrage für einen belastbaren Vorbescheid vorbereiten.
Rechenbeispiele für typische Grundstücksgrößen
Beispiel A: Kleines Einfamilienhaus-Grundstück. Grundstück: 400 m², GFZ: 0,8. Zulässige Geschossfläche: 320 m². Angenommen, zwei Vollgeschosse sind zulässig, dann liegen pro Vollgeschoss im Mittel 160 m² an. Mit einer GRZ von 0,3 wären maximal 120 m² Grundfläche erlaubt – realistisch ergibt sich also eher ein Grundriss von etwa 10 × 12 m, zwei Vollgeschosse plus nicht-vollgeschossiges Dachstudio. Du nutzt die GFZ fast vollständig, wenn Grundriss, Abstandsflächen und Erschließungsschächte klug organisiert sind.
Beispiel B: Mittleres Grundstück im Mischgebiet. Grundstück: 600 m², GFZ: 1,2. Zulässige Geschossfläche: 720 m². Mit GRZ 0,4 sind 240 m² Grundfläche möglich. Drei Vollgeschosse à 240 m² erscheinen rechnerisch stimmig. Bremse: maximale Gebäudehöhe oder Nachbarschaftseinfügung (§ 34 BauGB) kann de facto nur zwei Vollgeschosse erlauben. Dann bleibt GFZ ungenutzt – es sei denn, ein Staffelgeschoss wird so ausgelegt, dass es nicht vollgeschossig ist, aber hochwertigen Außenraum (Dachterrasse) bietet.
Beispiel C: Großes Areal mit Entwicklungsspielraum. Grundstück: 1.000 m², GFZ: 2,0. Zulässige Geschossfläche: 2.000 m². Bei GRZ 0,5 wären 500 m² Grundfläche zulässig. Vier Vollgeschosse à 500 m² sind rechnerisch möglich. In der Praxis begrenzen Abstandsflächen und Brandschutz die Fassadenlängen; Erschließungskerne und Fluchttreppen belegen Fläche. Eine Massstudie mit einem Baukörper 20 × 25 m zeigt, ob die Maßfigur stimmig ist. Ergänze Retentionsdach und Hofentsiegelung – das stärkt Argumente für die Umsetzung und kann bei der Gemeinde Bonuspunkte bringen.
Diese Beispiele zeigen: Die GFZ ist ein Rahmen, den du mit Geometrie, Regeln und guter Planung füllen musst. Erst wenn GRZ, Höhe, Abstände, Erschließung und Klimaauflagen zusammenpassen, wird die Zahl baubar.
Vorgehen bei Unklarheiten und Vorbescheid
Bei Unklarheiten empfiehlt sich eine Bauvoranfrage. Sie ist rechtlich verankert und führt zu einem Vorbescheid, der dich für definierte Fragen bindend absichert. So gehst du vor:
- Schritt 1: Frühgespräch. Kurztermin mit dem Sachbearbeiter im Bauamt, skizziere Vorhaben, stelle gezielt deine GFZ-/GRZ-Fragen, kläre Unterlagenbedarf. Bringe Lageplan, Fotos und eine tabellarische Flächenübersicht mit.
- Schritt 2: Voranfrage anlegen. Formuliere präzise Prüfgegenstände („Ist ein Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen und einem nicht vollgeschossigen Staffelgeschoss bei einer GFZ von 1,2 zulässig?“). Lege einen einfachen Lageplan, Grundriss-Schemata, Schnitt und Fassadenansichten bei.
- Schritt 3: Einreichen und nachfassen. Rechne mit einer Bearbeitungszeit von 4–12 Wochen, Gebühren je nach Gemeinde. Reagiere zügig auf Rückfragen und halte die Kommunikation transparent.
- Schritt 4: Vorbescheid nutzen. Mit positivem Vorbescheid planst du detailliert weiter oder sicherst dir Kaufpreis und Finanzierung. Bleibt er ausweichend, ziehe Architekt und Baurechtsanwalt hinzu und erwäge eine angepasste Variante.
Mustertext-Auszug: „Hiermit stelle ich eine Bauvoranfrage gem. § … zur Prüfung, ob auf dem Grundstück Flst.-Nr. …, Gemarkung …, ein Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss bei einer GFZ von 1,0 gemäß Bebauungsplan Nr. … zulässig ist. Beigefügt sind Lageplan M 1:500, Massenstudie und Flächenberechnung. Bitte um prüffähigen Vorbescheid.“
Extra-Tipp: Fallbeispiel mit 3D-Volumenvisualisierung
Nimm ein Grundstück mit 800 m², GFZ 1,2, GRZ 0,4. Zulässige Geschossfläche: 960 m², Grundfläche: 320 m². Baue dir in SketchUp oder Blender eine Box 16 × 20 m und 10–12 m hoch (z. B. Erdgeschoss und zwei Obergeschosse). Lege Baugrenzen und Abstandsflächen als Linien an. Jetzt „schneidest“ du die Box auf 320 m² Grundfläche und verteilst 960 m² auf die Vollgeschosse.
Teste Varianten: Ein drittes Vollgeschoss mit gleicher Fläche wird evtl. zu hoch. Also Staffelgeschoss zurücksetzen, z. B. auf 200 m². Prüfe die Vollgeschoss-Definition: Ist das Staffelgeschoss noch nicht vollgeschossig (Höhe, Flächenanteil)? Füge Balkone als separate Geometrien hinzu, die nicht in die GFZ zählen, aber Fassadentiefe und Belichtung beeinflussen.
Ergänze Klimaelemente: Retentionsdach (20–40 l/m² Speicher), extensive Dachbegrünung und ein entsiegelter Hof erhöhen die Entwässerungsleistung. Mit diesen Bausteinen kannst du im Bauamt die Ausnutzung visuell und technisch untermauern. Ein PDF mit Perspektiven, Grundrissskizzen und Flächentabelle macht die Diskussion schnell entscheidungsreif.
Extra-Tipp: Verhandlungsansatz mit Gemeinde und städtebauliche Verträge
Wenn du mehr Flexibilität brauchst (z. B. leicht höhere GFZ oder ein abweichendes Staffelgeschoss), können städtebauliche Verträge oder Befreiungen nach § 31 BauGB der Weg sein. Die Logik: Du bietest städtebauliche Qualitäten (Grün, Mobilität, Gestaltung, sozialer Mehrwert), die Kommune gewährt im Gegenzug eine Abweichung im vertretbaren Rahmen.
Typische Bausteine sind: Mobility-Hubs mit Carsharing, reduzierter Stellplatzschlüssel, Dachbegrünung mit Retention, zusätzliche Baumpflanzungen, barrierefreie Wege, öffentlich zugängliche Pocket-Parks oder eine freiwillige Sozialwohnungsquote. Alles wird planerisch und rechtlich präzise festgelegt – mit Pflichten, Fristen und Nachweisen.
Sei dir bewusst: Solche Verfahren sind politisch, brauchen Zeit und gute Kommunikation. Bereite ein klares Nutzenargument vor: „Mit 10 % mehr GFZ schaffen wir 6 zusätzliche leistbare Wohnungen, kompensieren über Retentionsdächer 80 m³ Regenwasser und pflanzen 12 klimaresiliente Bäume.“ Diese Konkretion zeigt Gemeinderäten, dass Mehrdichte Mehrwert erzeugt.
Zum Abschluss noch zwei häufige Fragen aus der Praxis:
Die GFZ ist der Quotient aus zulässiger Geschossfläche und Grundstücksfläche – sie steuert die Dichte deines Bauvorhabens. Praktisch rechnest du die Summe der Geschossflächen aller relevanten Vollgeschosse zusammen und teilst durch die Grundstücksfläche; umgekehrt multiplizierst du die GFZ mit der Grundstücksfläche, um die zulässige Summe zu erhalten. Keller werden in der Regel nicht angerechnet; Balkone meist nicht; Garagen oft separat – maßgeblich sind der B‑Plan und BauNVO § 20.
GRZ vs. GFZ? Die GRZ begrenzt die überbaubare Grundfläche (horizontal), die GFZ die Geschossfläche (vertikal). Den gültigen GFZ‑Wert findest du im B‑Plan oder beim Bauamt; ohne B‑Plan gilt die Einfügung nach § 34 BauGB. Erhöhungen sind möglich, aber selten und aufwendig – über Bebauungsplanänderung, Befreiungen oder städtebauliche Verträge. Für belastbare Auslegung und Optimierung empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Architekt oder Bauingenieur, während einfache Rechner für eine erste Einschätzung genügen. Wenn der B‑Plan unklar ist, bringt eine Bauvoranfrage mit Vorbescheid Rechtssicherheit.