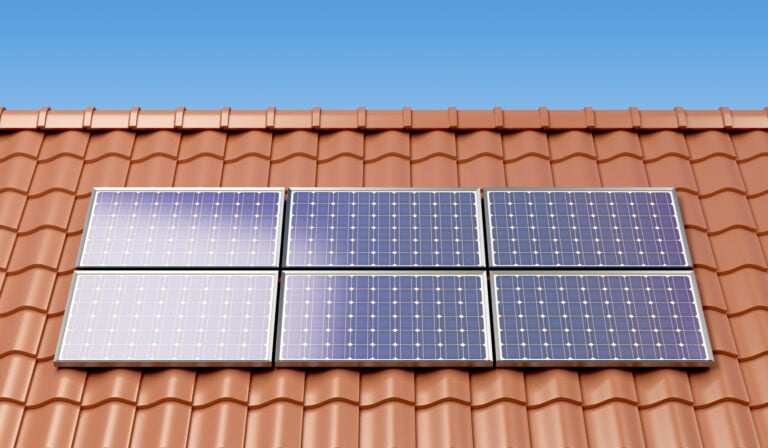THG-Quote für die Wallbox: Worauf kommt es an?
Wer ein Elektrofahrzeug besitzt, hat die Möglichkeit, die eingesparten Emissionen zertifizieren zu lassen und zu verkaufen. Allerdings kann man neben dem eigenen Auto auch die THG-Quote der Wallbox für die Ladesäule verkaufen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Ladesäule frei zugänglich ist. Wie hoch ist die Einsparung und welche Ladesäulen sind für die Treibhausgasminderungsquote zugelassen? Um…