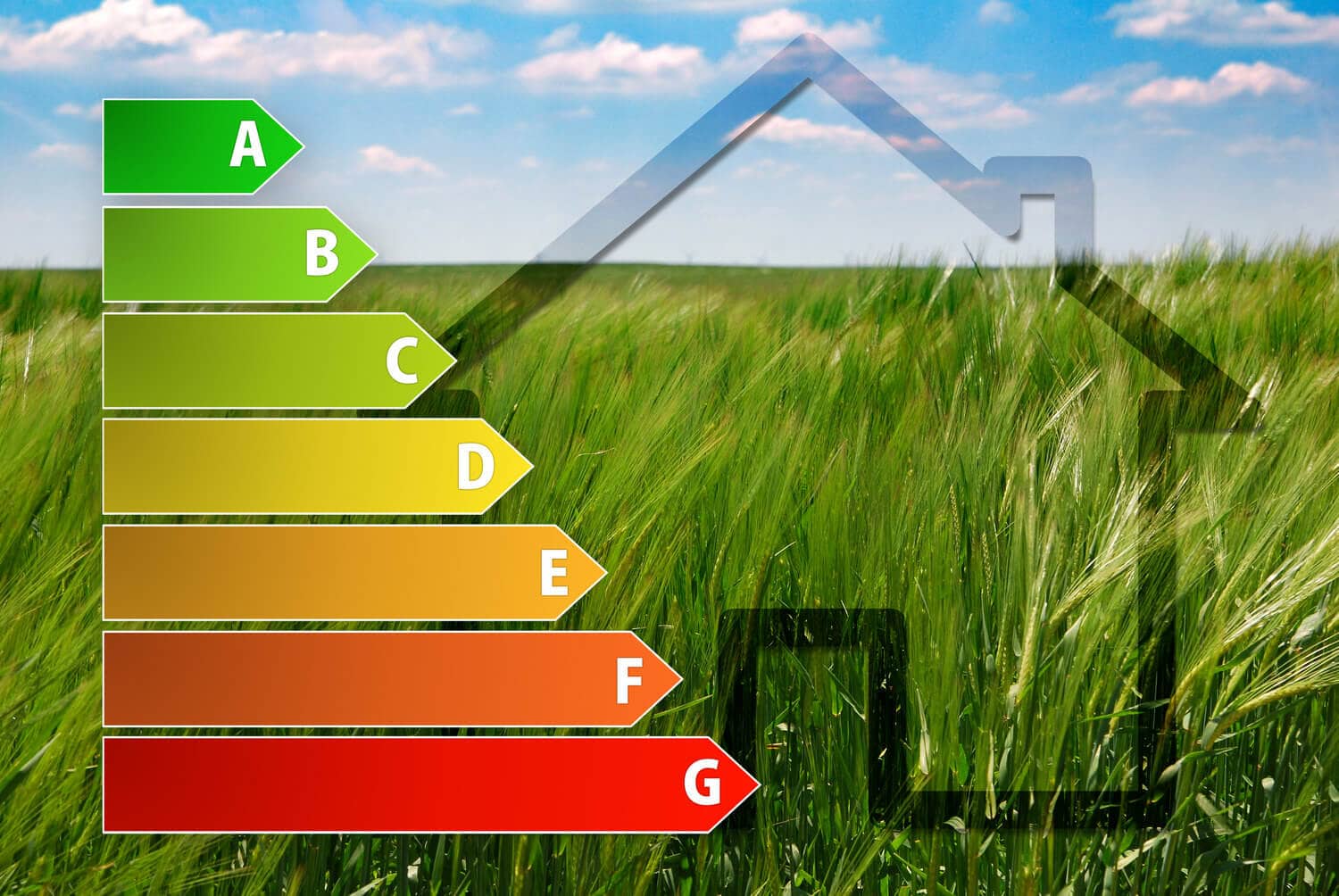Grunderwerbsteuer bei Schenkung: Wann sie anfällt

1. Kurzüberblick: Grunderwerbsteuer vs. Schenkungssteuer
Wenn du eine Immobilie geschenkt bekommst, stellst du dir zu Recht die Frage: Fällt Grunderwerbsteuer an – oder nur Schenkungssteuer? Der schnelle Unterschied: Die Grunderwerbsteuer (GrESt) besteuert den Erwerb von Grundstücken und Wohnungen nach dem Grunderwerbsteuergesetz, während die Schenkungssteuer (ErbStG) den Vermögenszuwachs beim Beschenkten erfasst. Bei einer „reinen“ Schenkung ist die GrESt grundsätzlich befreit, die Schenkungssteuer wird aber geprüft.
Die Praxis ist oft nicht schwarz-weiß. Sobald Gegenleistungen ins Spiel kommen – etwa Übernahme einer Hypothek, ein Vorbehalts‑Nießbrauch, ein lebenslanges Wohnrecht oder eine Rentenzahlung – spricht man häufig von einer „teilentgeltlichen“ Übertragung. Dann greift für den entgeltlichen Anteil die Grunderwerbsteuer, während für den unentgeltlichen Anteil die Schenkungssteuer zu prüfen ist. Wichtig ist: Doppelte Besteuerung desselben Werts soll vermieden werden – es wird aufgeteilt.
In kurzen Worten: Reine Schenkung = meist keine GrESt. Teilentgeltliche Schenkung = GrESt auf die Gegenleistung, Schenkungssteuer auf den Rest. Dazu kommen Bundesland-spezifische Steuersätze bei der GrESt (3,5–6,5%) sowie Freibeträge und Steuerklassen bei der Schenkungssteuer.
2. Wer ist steuerbefreit? Enge Angehörige und Voraussetzungen
Die gute Nachricht vorweg: Schenkungen von Immobilien sind grunderwerbsteuerlich in der Regel befreit. Das gilt nicht nur unter Eltern und Kindern, sondern für jede echte, unentgeltliche Übertragung. In der Praxis kommen Schenkungen allerdings besonders häufig im Familienkreis vor, weshalb du oft liest: „Eltern, Kinder, Enkel, Ehegatten und Lebenspartner“ – aber die Befreiung knüpft im Kern an den Schenkungscharakter, nicht nur an die Verwandtschaft.
Worauf das Finanzamt genau schaut: Ist es wirklich eine Schenkung ohne Gegenleistung? Erfolgt der Eigentumsübergang unmittelbar und ohne zwischengeschaltete Ketten? Gibt es Auflagen, die wirtschaftlich einer Gegenleistung gleichkommen? Die Antworten entscheiden, ob die Grunderwerbsteuer ausgelöst wird oder nicht.
Voraussetzungen für die Befreiung (unentgeltlicher Erwerb, direkte Übertragung)
Für die grunderwerbsteuerliche Befreiung bei einer Schenkung sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Der Erwerb ist objektiv unentgeltlich. Das heißt: Du erwirbst das Eigentum ohne Kaufpreis und ohne wirtschaftlich ins Gewicht fallende Gegenleistung. Die bloße Eintragung eines Vorbehalts (z. B. Nießbrauch deiner Eltern) ist häufig unschädlich, sobald keine zusätzliche Zahlung oder Schuldübernahme erfolgt. In vielen Konstellationen gilt der Vorbehalts‑Nießbrauch oder das Wohnrecht als Belastung, die die Unentgeltlichkeit nicht zerstört – je nach Ausgestaltung kann er aber als Teilentgelt bewertet werden.
- Die Übertragung ist unmittelbar. Das heißt, die Immobilie geht direkt vom Schenker auf den Beschenkten über, ohne künstliche Zwischenschritte oder Gestaltungen über Dritte. Je „sauberer“ der Notarvertrag ist, desto leichter ist die Befreiung.
Bei Unsicherheit empfiehlt es sich, vorab eine Steueranfrage zu stellen oder die Gestaltung notariell und steuerlich prüfen zu lassen – gerade, wenn Rechte (Nießbrauch/Wohnrecht), Darlehen oder Ausgleichszahlungen involviert sind.
3. Wann trotz Schenkung Steuer anfällt
Grunderwerbsteuer kann trotz Schenkung entstehen, wenn eine Gegenleistung vereinbart ist. Typische Auslöser in der Praxis sind:
- Übernahme von Darlehen, Grundschulden oder anderen dinglichen Belastungen durch dich.
- Vereinbarung von Leibrenten, Pflegeleistungen oder Ausgleichszahlungen an Geschwister.
- Bestellung von Rechten (z. B. Wohnrecht) zugunsten des Schenkers oder Dritter, sofern sie wirtschaftlich als Gegenleistung zu werten sind.
- Übertragung an Personen außerhalb des engen Familienkreises, verbunden mit Auflagen oder Verpflichtungen, die einen Wert haben.
Kurz gesagt: Immer wenn du „etwas dafür gibst“, wird zumindest ein Teil des Vorgangs entgeltlich. Dieser entgeltliche Teil wird mit GrESt belegt. Der übrige, unentgeltliche Teil unterliegt dann der Schenkungssteuer – mit Freibeträgen und steuerlichen Klassen gemäß Erbschaftsteuerrecht.
Beispiele: Geschwister, Stiefkinder, gemeinnützige Auflagen
- Geschwister: Erhältst du von deinem Bruder eine Wohnung „reine Schenkung“, fällt normalerweise keine GrESt an. Übernimmst du jedoch die auf dem Objekt lastende Hypothek (z. B. 120.000 Euro), wird in Höhe dieser Gegenleistung GrESt fällig. Der darüber hinausgehende Wert (Marktwert minus 120.000 Euro) ist schenkungsteuerlich relevant.
- Stiefkinder: Auch hier gilt die Logik „unentgeltlich = grunderwerbsteuerfrei“. Oft spielen aber Ausgleichszahlungen an leibliche Kinder oder andere Angehörige eine Rolle, die den entgeltlichen Anteil begründen und GrESt auslösen.
- Gemeinnützige Auflagen: Wenn die Schenkung mit der Auflage verbunden ist, dauerhaft eine Zahlung an eine Stiftung zu leisten oder Instandhaltungskosten in bestimmter Höhe zu tragen, können diese Auflagen als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung gelten. Dann wird der Barwert der Verpflichtung zur Grundlage für die Bemessung der GrESt.
4. Teilentgeltliche Schenkungen: Nießbrauch, Wohnrecht, Hypothekenübernahme
Teilentgeltlich bedeutet: Ein Teil ist Schenkung, ein Teil ist entgeltlich. In der Immobilienpraxis sind drei Gestaltungen besonders häufig: Vorbehalts‑Nießbrauch, lebenslanges Wohnrecht und Übernahme von Verbindlichkeiten (Hypotheken).
- Nießbrauch/Wohnrecht: Der Schenker bleibt wirtschaftlich abgesichert, weil er weiter Mieteinnahmen bezieht oder dort wohnt. Grunderwerbsteuerlich werden diese Rechte häufig als Teilentgelt gewertet, weil du die Immobilie belastet übernimmst bzw. die Eintragung des Rechts „als Preis“ für die Übertragung ermöglichst. Der Wert des Rechts zählt dann zur Gegenleistung.
- Hypothekenübernahme: Übernimmst du die dingliche Schuld inklusive der Valuta, ist die übernommene Restschuld regelmäßig die Gegenleistung. Darauf fällt GrESt an – mit dem Landessteuersatz des Belegenheitsbundeslands.
Je nach Gestaltung kann der entgeltliche Teil sehr unterschiedlich ausfallen. Das ist nicht nur für die GrESt relevant, sondern auch für die Schenkungssteuer, weil der unentgeltliche Anteil dort der Besteuerung (abzüglich Freibeträge) unterliegt.
Bewertung von Nießbrauch und Wohnrecht, Extra-Tipp: steuerliche Auswirkungen prüfen
Für die Bewertung von Nießbrauch oder Wohnrechten werden in der Praxis Barwerte ermittelt. Ausgangspunkte sind der jährliche Vorteil (z. B. ortsübliche Kaltmiete oder Nutzungswert) und ein Vervielfältiger, der sich aus Restlebenserwartung und einem gesetzlich vorgegebenen Zinssatz ableitet. Ein Beispiel:
- Immobilie: Verkehrswert 600.000 Euro, monatliche Nettokaltmiete 1.500 Euro, Jahreswert 18.000 Euro.
- Vorbehalts‑Nießbrauch: Faktor (vereinfacht) 12,5 → Barwert ca. 225.000 Euro.
Wird der Nießbrauch als Gegenleistung behandelt, wäre der entgeltliche Teil 225.000 Euro (GrESt-Bemessung), der unentgeltliche Teil 375.000 Euro (Schenkungssteuer-Bemessung abzüglich Freibetrag). Beachte: In Einzelfällen kann der Vorbehalts‑Nießbrauch grunderwerbsteuerlich auch als bloße Minderung des Werts gewertet werden – die vertragliche Ausgestaltung und Rechtsprechung sind entscheidend. Daher: Extra‑Tipp – lasse den konkreten Entwurf steuerlich prüfen, bevor du zum Notar gehst.
5. Bewertung und Berechnung: Verkehrswert, Landessteuersatz, Rechenbeispiele
Die Grunderwerbsteuer bemisst sich beim entgeltlichen oder teilentgeltlichen Erwerb nach der Gegenleistung (§ 8 GrEStG). Das kann sein: Kaufpreis, übernommene Darlehen/Grundschulden, der Barwert von Renten, Nießbrauch oder anderen auflageähnlichen Leistungen. Der Steuersatz richtet sich nach dem Bundesland der Immobilie, z. B. 3,5% (z. B. Bayern), 5% (z. B. Sachsen‑Anhalt), 6% (z. B. Berlin) oder 6,5% (z. B. NRW, Brandenburg, Saarland).
Rechenbeispiel A – reine Schenkung:
- Verkehrswert 500.000 Euro, keine Gegenleistung, keine Schuldübernahme, kein entgeltliches Element.
- GrESt: 0 Euro (Befreiung). Schenkungssteuer: Bemessungsgrundlage 500.000 Euro, abzüglich Freibetrag (z. B. Kind 400.000 Euro, verbleiben 100.000 Euro → Besteuerung nach Steuerklasse I).
Rechenbeispiel B – gemischte Schenkung mit Hypothekenübernahme:
- Verkehrswert 600.000 Euro, übernommene Restschuld 150.000 Euro.
- GrESt-Bemessungsgrundlage: 150.000 Euro. Bei Steuersatz 6,5% → 9.750 Euro GrESt. Unentgeltlicher Teil: 450.000 Euro, schenkungsteuerlich zu prüfen (Freibeträge!).
Rechenbeispiel C – Vorbehalts‑Nießbrauch als Gegenleistung:
- Verkehrswert 600.000 Euro, Barwert Nießbrauch 225.000 Euro (wie oben).
- GrESt: Bemessungsgrundlage 225.000 Euro. Bei 5% → 11.250 Euro. Schenkungssteuer auf 375.000 Euro (Freibeträge beachten).
Wenn sowohl Hypothek als auch Nießbrauch bestehen, summieren sich üblicherweise die entgeltlichen Elemente zur Bemessungsgrundlage der GrESt – sofern beides Gegenleistung ist. In der Praxis prüft das Finanzamt den Vertrag sehr genau.
Schritt-für-Schritt-Berechnung mit Beispielrechner
- Schritt 1: Ermittle den Verkehrswert. Nutze ein aktuelles Verkehrswert‑Gutachten oder belastbare Marktindikatoren (Vergleichspreise, Bodenrichtwert, Mietspiegel). Tipp: Ein neutrales Gutachten kann überhöhten Schätzungen vorbeugen und spart im Zweifel Steuern.
- Schritt 2: Sammle alle Gegenleistungen. Dazu zählen übernommene Schulden (Valuta), Bar‑ oder Rentenzahlungen, der Barwert von Nießbrauch/Wohnrecht oder sonstige Auflagen.
- Schritt 3: Bemessungsgrundlage. Addiere alle Gegenleistungen zum entgeltlichen Teil. Der unentgeltliche Teil = Verkehrswert minus Gegenleistungen.
- Schritt 4: Landessteuersatz anwenden. Prüfe den GrESt‑Satz deines Bundeslands (3,5–6,5%). Multipliziere ihn mit der Bemessungsgrundlage.
- Schritt 5: Schenkungssteuer checken. Ziehe Freibeträge nach ErbStG ab (z. B. Ehegatte 500.000 Euro, Kind 400.000 Euro, Enkel 200.000 Euro), ermittle den steuerpflichtigen Erwerb und wende die entsprechende Steuerklasse an.
- Schritt 6: Ergebnis dokumentieren. Halte die Aufteilung schriftlich fest (z. B. in einer „Beispielrechnung“), damit Notar und Finanzamt alle Werte nachvollziehen können.
Mini‑Rechner (vereinfacht): GrESt = (Gegenleistungen) × (Landessteuersatz). Schenkungssteuer = (Verkehrswert − Gegenleistungen − Freibetrag) × (Tarif). Die gesamte Steuerlast ist die Summe aus beiden – häufig geringer als befürchtet, wenn Freibeträge gut genutzt werden.
6. Gesellschaftsanteile und die 90%-Regel
Nicht nur Grundstücke selbst, auch Anteile an grundbesitzenden Gesellschaften (GmbH, KG, GmbH & Co. KG) können Grunderwerbsteuer auslösen. Hintergrund ist die sogenannte 90%-Regel: Wenn innerhalb eines Zehnjahreszeitraums mindestens 90% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen, wird ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang fingiert – auch ohne unmittelbaren Grundstückskauf.
Bei Schenkungen von Gesellschaftsanteilen bedeutet das: Schenkst du deinem Kind 60% heute und weitere 30% in drei Jahren, und es wechseln insgesamt mindestens 90% innerhalb von zehn Jahren, kann GrESt ausgelöst werden. Die Bemessungsgrundlage ist dabei der Grundbesitzwert, der der Gesellschaft zuzurechnen ist (nicht einfach der Nominalwert deiner Anteile). Außerdem gibt es bei Personengesellschaften besondere Vorschriften zum Gesellschafterwechsel, die ähnliche Schwellen enthalten.
Praxistipp: Plane Anteilsschenkungen mit Blick auf die Zehnjahresfrist und die 90%-Grenze. Wird die Schwelle nicht gerissen, bleibt es grunderwerbsteuerfrei. Achte darauf, dass konzerninterne Ausnahmen, Altbeteiligungen oder Streubesitz die Quote beeinflussen können – ein Gesellschaftsrechtler mit Steuerfokus ist hier Gold wert.
7. Formalitäten: Notar, Grundbucheintrag, Freistellungsbescheid
Eine Immobilienschenkung erfordert immer den Gang zum Notar. Der Notar erstellt den Schenkungsvertrag, klärt Auflagen (Nießbrauch, Wohnrecht), lässt Vollmachten prüfen und reicht den Vorgang beim Grundbuchamt ein. Parallel meldet er den Erwerbsvorgang dem Finanzamt – in der Praxis dem Grunderwerbsteuer‑Finanzamt und ggf. dem Erbschaft‑ und Schenkungssteuer‑Finanzamt.
Damit das Grundbuch dich als neuen Eigentümer einträgt, brauchst du üblicherweise entweder die Grunderwerbsteuer‑Unbedenklichkeitsbescheinigung (bei steuerpflichtigen Fällen nach Zahlung) oder einen Freistellungs- bzw. Nichtfeststellungsbescheid (bei befreiten Schenkungen). Ohne dieses Dokument blockt das Grundbuchamt den Eigentumswechsel.
Kosten: Rechne mit Notarkosten von etwa 0,6–0,8% des Verkehrswerts plus Grundbuchkosten. Kommen Gutachten oder weitere Beglaubigungen hinzu, steigt die Summe. Gute Vorbereitung spart hier Zeit und oft mehrere hundert Euro.
Wie Sie den Freistellungsbescheid bekommen
- Schritt 1: Notarvertrag richtig gestalten. Vereinbare schon im Entwurf klar, dass es sich um eine unentgeltliche Schenkung handelt, und dokumentiere ggf. das Fehlen von Gegenleistungen. Rechte wie Nießbrauch sollten sauber beschrieben sein – inklusive Hinweis zur steuerlichen Bewertung.
- Schritt 2: Unterlagen zusammentragen. Halte Personalausweise, Grundbuchauszug, Belastungsübersichten, evtl. Darlehensstände, Mietverträge (bei Nießbrauch/Mieten) und ein Verkehrswert‑Gutachten bereit.
- Schritt 3: Meldung ans Finanzamt. Der Notar übermittelt die Vertragsdaten. Ergänze – auf Aufforderung – Nachweise zur Unentgeltlichkeit (z. B. Bestätigung, dass keine Zahlungen fließen, oder dass eine Schuld beim Schenker verbleibt).
- Schritt 4: Bescheid abwarten. Das Finanzamt prüft und erteilt entweder den Freistellungsbescheid (Nichtfestsetzung) oder fordert GrESt an. Bei gemischten Fällen kann es Rückfragen zur Bewertung geben.
- Schritt 5: Grundbuchvollzug. Mit Bescheid und der notariellen Auflassungsvormerkung steht dem Eigentumswechsel regelmäßig nichts mehr im Weg.
8. Freibeträge, Schenkungssteuer und Wechselwirkungen
Die Schenkungssteuer richtet sich nach deinem persönlichen Verhältnis zum Schenker sowie nach der Höhe des unentgeltlichen Erwerbs. Wichtig sind die Freibeträge (alle zehn Jahre nutzbar): Ehegatte/eingetragener Lebenspartner 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro, Enkel 200.000 Euro, Eltern/Großeltern bei Erwerb von Kindern/Enkeln 100.000 Euro; für Geschwister, Nichten/Neffen, Lebensgefährten ohne Eintragung etc. gelten geringere Freibeträge (20.000 Euro) und ungünstigere Steuerklassen.
Wechselwirkung zur Grunderwerbsteuer: Bei teilentgeltlichen Schenkungen wird der entgeltliche Anteil für GrESt herangezogen, der unentgeltliche Anteil für Schenkungssteuer – die Summe der Bemessungsgrundlagen entspricht im Normalfall dem Verkehrswert. Dadurch vermeidest du, dass zwei Steuern denselben Euro doppelt belasten. Achtung: Bei falscher vertraglicher Einordnung (z. B. „Kauf mit geringem Kaufpreis“) drohen unnötige Doppelbelastungen oder fehlende Freibeträge.
Praxisnutzen: Wenn du die Freibeträge klug ausnutzt, kann die Schenkungssteuer auf Null fallen, während die GrESt nur einen überschaubaren entgeltlichen Teil trifft (z. B. übernommene Restschuld). Prüfe dabei auch, ob ein Nießbrauch den unentgeltlichen Wert reduziert und so die Freibeträge entlastet – während er grunderwerbsteuerlich als Gegenleistung zu berücksichtigen sein kann.
9. Planungstipps und zeitliche Gestaltung (10‑Jahres‑Fenster)
Mit guter Planung lassen sich Grunderwerbsteuer und Schenkungssteuer steuern. Das wichtigste Instrument ist das Zehnjahresfenster: Freibeträge erneuern sich alle zehn Jahre. Dadurch kann es Sinn machen, Übertragungen zu staffeln. Beispiel: Eltern schenken heute 400.000 Euro (Freibetrag Kind) und in elf Jahren weitere 400.000 Euro – jeweils steuerfrei in der Schenkungssteuer.
Wenn Gesellschaftsanteile im Spiel sind, gilt gleichzeitig die 90%-Regel innerhalb von zehn Jahren bei grundbesitzenden Gesellschaften. Eine geschickte Streckenplanung kann sowohl die Schenkungsfreibeträge nutzen als auch die GrESt‑Schwelle (90%) vermeiden.
Behalte außerdem im Blick: Immobilienwerte schwanken. In Hochphasen kann ein Verkehrswert‑Gutachten helfen, den Wert sachlich zu begründen, in schwächeren Phasen erleichtert der niedrigere Marktwert die Freibetragsnutzung. Plane auch mit Blick auf Pflege, Unterhalt und Liquidität des Schenkers – ein Vorbehalts‑Nießbrauch bringt laufende Einnahmen, die Absicherung im Alter ermöglichen.
Extra-Tipp: Gestaffelte Schenkungen in zehnjährigen Intervallen
- Schritt 1: Werte und Ziele definieren. Welche Immobilien oder Anteile willst du übertragen? Welche Freibeträge stehen zur Verfügung?
- Schritt 2: Übertragungsplan bauen. Lege fest, welche Objektteile oder Anteile jetzt und welche später übertragen werden – z. B. Miteigentumsanteile, Wohnung 1 jetzt, Wohnung 2 in elf Jahren.
- Schritt 3: Rechte klug kombinieren. Vorbehalts‑Nießbrauch kann die Schenkungswerte senken, ohne auf Mieteinnahmen zu verzichten. Achte aber auf die grunderwerbsteuerliche Behandlung als Teilentgelt.
- Schritt 4: Dokumente vorbereiten. Sammle Gutachten, Mietverträge, Darlehensstände und entwirf klare Notarklauseln zur Unentgeltlichkeit bzw. Teilentgeltlichkeit.
10. Risiken, Fallstricke und Checkliste
Die größten Fallstricke lauern in Details. Ein falsch formulierter Notarvertrag kann eine eigentlich befreite Schenkung in einen grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang drehen. Unterschätzte Gegenleistungen (z. B. kleine Rente „für den Notgroschen“) sind häufig der Auslöser. Auch die Bewertung von Nießbrauch und Wohnrechten ist sensibel – zu niedrige Ansätze können Nachfragen des Finanzamts oder Schätzungen nach sich ziehen.
Achtung bei Patchwork‑Konstellationen: Übertragungen an Stiefkinder, Partner ohne Eintragung oder Geschwister sind schenkungsteuerlich deutlich schlechter gestellt (niedrige Freibeträge). Bei gemischten Schenkungen kann das zu spürbaren Gesamtlasten führen. Prüfe außerdem Grundbuchlasten genau: Nicht jede eingetragene Grundschuld ist valutiert – entscheidend für die GrESt ist die übernommene Valuta, nicht der Nominalbetrag der Grundschuld.
Checkliste – so gehst du sicher in den Notartermin:
- Prüfe, ob der Vorgang vollständig unentgeltlich ist – oder welcher Anteil als Gegenleistung gilt (Schuldübernahme, Nießbrauch, Wohnrecht, Rente).
- Besorge ein aktuelles Verkehrswert‑Gutachten oder valide Marktbelege zur Wertargumentation.
- Liste alle bestehenden Belastungen auf und kläre, ob die Valuta übernommen wird oder beim Schenker bleibt.
- Kläre mit dem Notar, wie die Unentgeltlichkeit/Teilentgeltlichkeit rechtssicher formuliert wird.
- Lasse die steuerlichen Konsequenzen (GrESt‑Satz deines Bundeslands, Freibeträge Schenkung) vorab berechnen.
- Dokumentiere Barwerte von Rechten (Nießbrauch/Wohnrecht) nachvollziehbar – inklusive Rechenweg und Annahmen.
- Plane den zeitlichen Ablauf (10‑Jahresfenster, 90%-Regel bei Gesellschaften).
- Halte eine Dokumentenmappe bereit: Ausweise, Grundbuchauszug, Darlehensstände, Mietverträge, Vollmachten, Heirats-/Partnerschaftsurkunden.
Extra-Tipp: Digitaler Übergabe-Check (Dokumente + Fristen)
Erstelle dir einen digitalen Ordner mit drei Unterrubriken: „Vor dem Notar“ (Gutachten, Belastungsübersicht, Vertragsentwurf), „Steuer“ (Gegenleistungsaufstellung, Barwert‑Rechnung, Freibetragsprüfung) und „Grundbuch“ (Freistellung/Unbedenklichkeitsbescheinigung, Vormerkung, Eintragungsbestätigung). Lege dir Fristen als Kalendererinnerung an: Notartermin, Frist zur Finanzamtsantwort, voraussichtlicher Grundbuchvollzug. So behältst du alles im Blick – und kannst Unterlagen bei Rückfragen sofort nachreichen.
11. Praxisbeispiele und häufige Szenarien
Fall 1 – Eltern an Kind mit Hypothek:
Deine Mutter schenkt dir ein Haus (Verkehrswert 700.000 Euro). Auf dem Haus lastet ein Darlehen mit Valuta 100.000 Euro, das du übernimmst. Ergebnis: GrESt fällt auf die Gegenleistung 100.000 Euro an – bei 6,5% also 6.500 Euro. Der unentgeltliche Teil 600.000 Euro unterliegt der Schenkungssteuer – nach Abzug des Freibetrags (400.000 Euro) bleiben 200.000 Euro steuerpflichtig zum Tarif der Steuerklasse I. Mit gutem Timing (z. B. Vorerwerbe prüfen, zweite Schenkung nach zehn Jahren) lässt sich die Gesamtlast senken.
Fall 2 – Vorbehalts‑Nießbrauch statt Miete:
Du erhältst eine vermietete Wohnung (Wert 400.000 Euro), deine Eltern behalten den Nießbrauch (Jahresmiete 12.000 Euro, Barwert 150.000 Euro). Wird der Nießbrauch grunderwerbsteuerlich als Teilentgelt behandelt, zahlst du GrESt auf 150.000 Euro. Der unentgeltliche Teil 250.000 Euro trifft auf die Schenkungssteuer – beim Kind möglicherweise vollständig durch Freibetrag gedeckt. Vorteil: Deine Eltern sind durch Mieten abgesichert, die Gesamtabgaben bleiben überschaubar.
Fall 3 – Geschwisterübertragung mit Ausgleich:
Deine Schwester überträgt dir eine Wohnung (500.000 Euro). Ihr vereinbart eine Ausgleichszahlung von 200.000 Euro an sie. Ergebnis: GrESt fällt auf 200.000 Euro an (Gegenleistung), Schenkungssteuer auf 300.000 Euro. Achtung: Zwischen Geschwistern gilt ein sehr niedriger Freibetrag (20.000 Euro) und ungünstiger Tarif, die Steuerlast kann also hoch ausfallen. Alternative: In der Familie erst an Eltern rückübertragen und dann an dich? Solche Gestaltungen sind heikel und werden auf Missbrauch geprüft – unbedingt beraten lassen.
Fall 4 – Übertragung an Stiefkind mit Wohnrecht:
Du schenkst deinem Stiefkind ein Haus (600.000 Euro) und behältst ein lebenslanges Wohnrecht (Barwert 180.000 Euro). Wird das Wohnrecht als Gegenleistung eingestuft, fällt GrESt auf 180.000 Euro an. Der unentgeltliche Teil 420.000 Euro trifft schenkungsteuerlich auf einen Freibetrag von 20.000 Euro, der Rest wird in Steuerklasse II/III besteuert – je nach Konstellation. Ergebnis: Hier kann eine Staffelung oder ein Nießbrauch statt Wohnrecht steuerlich günstiger sein.
Fall 5 – Anteile an einer GmbH mit Immobilie (90%-Regel):
Du schenkst deinem Sohn 60% der Anteile an deiner Immobilien‑GmbH heute und planst weitere 30% in fünf Jahren. Damit wechseln 90% innerhalb von zehn Jahren – es droht GrESt auf den Grundbesitzwert der GmbH. Lösung: Entweder zeitliche Streckung über mehr als zehn Jahre, Einbindung weiterer Familienmitglieder (Streubesitz), oder Überlegung einer Übertragung von Einzelobjekten statt Anteilen – stets mit fachlicher Begleitung.
Fall 6 – Gemeinnützige Auflage:
Dein Onkel schenkt dir ein Mehrfamilienhaus (1,2 Mio. Euro) unter der Auflage, jährlich 10.000 Euro an eine Stiftung zu zahlen, solange du Eigentümer bist. Der Barwert dieser Leistung kann als Gegenleistung gelten und GrESt auslösen. Je nach Bewertung (Zinssatz, Laufzeit) kommen fünf- oder sechsstellige Bemessungsgrundlagen zusammen. Fazit: Auflagen genau quantifizieren und bewerten lassen.
Extra‑Praxisnutzen: Für alle Fälle lohnt ein „Beispielrechner“ mit drei Spalten: Verkehrswert, Gegenleistungen (mit Barwerten), unentgeltlicher Teil. Ergänze darunter die beiden Steuern mit Sätzen und Freibeträgen. So entdeckst du Stellschrauben, bevor der Vertrag fix ist.
12. Fazit und nächste Schritte
Bei der „Grunderwerbsteuer bei Schenkung“ gilt: Reine Schenkungen sind in der Regel grunderwerbsteuerfrei, aber schon kleine Gegenleistungen können GrESt auslösen. Nießbrauch, Wohnrecht und die Übernahme von Hypotheken sind die Klassiker der gemischten Schenkung – mit dem Effekt, dass du GrESt auf die Gegenleistung und Schenkungssteuer auf den Rest bezahlst. Mit kluger Gestaltung, sauberer Bewertung und Nutzung der Zehnjahres‑Freibeträge lassen sich die Abgaben oft deutlich senken.
Deine nächsten Schritte:
- Kläre, ob dein Vorgang vollständig unentgeltlich ist oder welcher Teil als Gegenleistung zählt.
- Sichere den Verkehrswert ab – idealerweise durch ein Gutachten.
- Plane die zeitliche Gestaltung (10‑Jahres‑Fenster für Freibeträge, 90%-Regel bei Gesellschaftsanteilen).
- Lass den Vertragsentwurf vor dem Notartermin steuerlich prüfen und bereite die Unterlagenmappe (Dokumente + Fristen) vor.
- Bitte den Notar, die Befreiung klar zu beantragen und sorge für den Freistellungsbescheid bzw. die Unbedenklichkeitsbescheinigung für das Grundbuch.
Wenn du diese Punkte beherzigst, holst du dir die Rechtssicherheit, die du brauchst – und vermeidest, dass zwischen Schenkungssteuer und Grunderwerbsteuer unnötig Geld liegen bleibt.