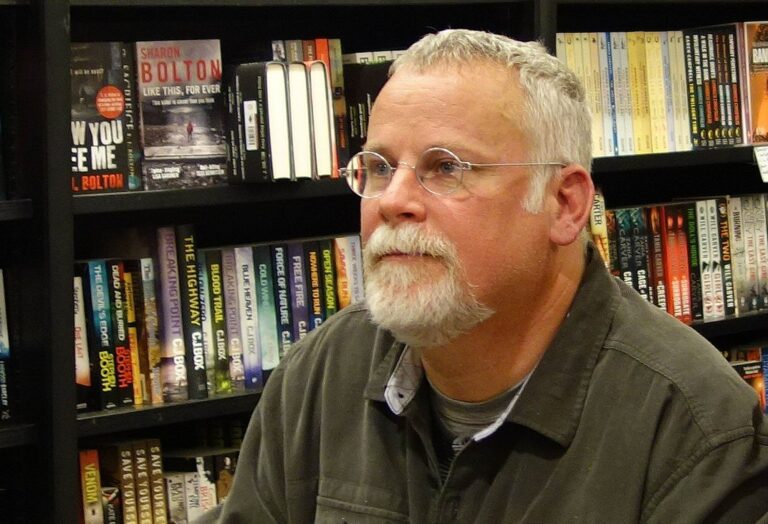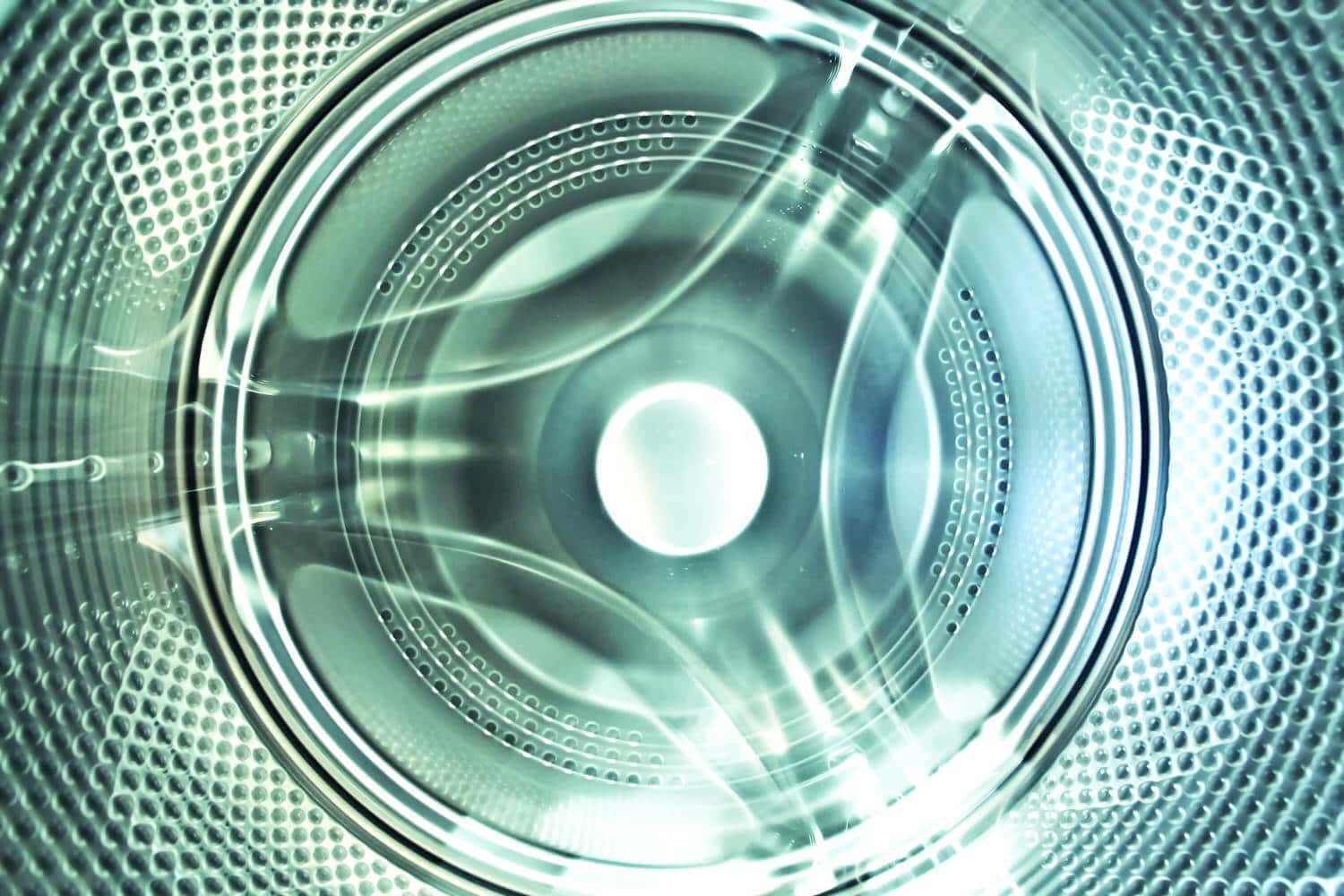Liegenschaftskarte: Inhalte & Bestellung

Kurzüberblick: Definition und rechtliche Bedeutung
Die Liegenschaftskarte ist der „amtliche Blick“ auf Grundstücke: ein maßstäblicher Auszug aus dem Liegenschaftskataster (ALKIS), der Flurstücke, Gebäude und Nutzungen zeigt. Wenn du einen „Auszug aus dem Liegenschaftskataster“ bestellst, erhältst du genau diese Darstellung – je nach Bundesland auch als „Flurkarte“ bezeichnet. Die Karte dient als grafisches Gegenstück zum Grundbuch, bildet Grenzen und Bezeichnungen ab und ist für viele Vorhaben die verlässliche Grundlage.
Rechtlich ist die Liegenschaftskarte ein amtliches Dokument, aber nicht für jeden Zweck allein ausschlaggebend. Grenzen sind maßstäblich dargestellt, doch bei Grenzstreitigkeiten zählt am Ende die Grenzfeststellung durch Vermessungsfachleute. Für bestimmte Amtszwecke (z. B. Grundbuchanträge, Bauanträge) benötigst du häufig eine beglaubigte Ausfertigung. Diese bestätigt, dass der Auszug unverändert und aktuell aus dem Kataster stammt – und wird mit Stempel und Dienstsiegel versehen.
Wichtig ist die Abgrenzung zu anderen Plänen: Ein Lageplan (z. B. für den Bauantrag) ist eine aufbereitete, zweckbezogene Planunterlage eines ÖbVI oder Architekten – darin steckt oft ein Katasterauszug, aber ergänzt um Höhen, Abstandsflächen, Baulinien. Die Liegenschaftskarte selbst ist neutral und flächendeckend, nicht projektspezifisch. Und noch ein Begriff: Die „Flurkarte“ ist vielerorts lediglich die traditionelle Bezeichnung der Liegenschaftskarte.
Inhalte der Karte (Flurstücke, Gebäude, Nutzung, Grenzpunkte)
Im Zentrum der Liegenschaftskarte stehen die Flurstücke: Sie sind die kleinsten buchungsfähigen Einheiten des Katasters, mit klar abgegrenzten Flurstücksgrenzen und einer Flurstücksnummer. Diese Nummer führt in der Liegenschaftskarte nicht zu Eigentümerdaten – die finden sich im Grundbuch, nicht in der Karte. Auch Vermerke wie Hypotheken oder Dienstbarkeiten sind nicht Teil des Kartenbilds, wohl aber die grafische Lage und Nummernfolgen, die das Auffinden und Zuordnen ermöglichen.
Gebäude erscheinen als Umrisse im Grundriss, häufig mit Kennzeichnungen wie Hausnummern. Die Darstellung zeigt, wo ein Gebäude im Verhältnis zu Grenzen liegt, nicht aber Details wie Nutzfläche, Geschosszahl oder Baujahr. Gerade Anbauten, Garagen und Nebengebäude sind wichtig, weil sie im Grenzbezug stehen können. Beachte: Zwischen Bauausführung und kartografischer Aktualisierung kann Zeit vergehen – neue Bauten erscheinen oft erst nach der Gebäudeeinmessung und Übernahme ins ALKIS.
Die Nutzungsarten geben Auskunft über die Art der Flächennutzung: Siedlung, Landwirtschaft, Wald, Wasser oder Verkehrsflächen. Sie liefern dir auf einen Blick Hinweise, ob es sich um bewohnte Bereiche, Ackerland oder Infrastruktur handelt. Diese Angaben sind besonders hilfreich, wenn du mehrere Flurstücke vergleichst oder eine erste Bewertung der Lage vornimmst. Topografische Höhenlinien oder Baugrundinformationen gehören nicht zur Liegenschaftskarte; dafür sind andere Fachkarten zuständig.
Grenzpunkte sind die fixen Bezugspunkte der Flurstücksgrenzen. Sie können als Grenzsteine, Bolzen oder andere Abmarkungen vorliegen und sind im Kataster mit Koordinaten verzeichnet. Die Karte zeigt ihre Lage und häufig spezielle Symbolik; in ALKIS werden dabei landeseinheitliche Darstellungsregeln genutzt. Wichtig: Ob ein Grenzpunkt vor Ort tatsächlich sichtbar abgemarkt ist, ergibt sich oft erst durch die örtliche Überprüfung oder eine Grenzanzeige durch einen ÖbVI.
Weitere Inhalte sind Verkehrswege, Gewässer, Gemarkungs- und Flurgrenzen sowie Hausnummern und Straßennamen. Nicht zu sehen sind Baulasten, private Dienstbarkeiten oder Leitungsrechte; diese stehen in separaten Verzeichnissen (z. B. Baulastenverzeichnis, Leitungsinformationssysteme). Wenn du solche Belastungen klären willst, brauchst du ergänzende Auszüge und Auskünfte jenseits der Liegenschaftskarte.
Symbole und Legende
Die Symbolik ist standardisiert, kann aber je nach Bundesland in Farbe und Linienstärke variieren. Grenzen werden in der Regel als durchgezogene Linien mit Markierungen an Grenzpunkten dargestellt; Flurstücksnummern stehen gut lesbar in den jeweiligen Flächen. Gebäude erscheinen als geschlossene Umrisse; öffentliche Flächen sind oft gesondert gekennzeichnet. Eine Legende erklärt, welche Linienarten, Schraffuren und Kürzel verwendet werden und wie Nutzungsarten kodiert sind.
Zudem enthält der Auszug eine Maßstabsleiste, ein Koordinatengitter oder Randkoordinaten sowie häufig einen Nordpfeil. Prüfe auf dem Auszug auch Datum und Versionsstand – so erkennst du, wie aktuell die Daten sind. Bei Unklarheiten hilft die Legende, Missverständnisse zu vermeiden; sie ist die „Übersetzung“ der kartografischen Sprache in Klartext.
Varianten & Formate (Papier, PDF, Shape, NAS, DXF, Maßstäbe)
Liegenschaftskarten kannst du sowohl in Papierform als auch digital beziehen. Für viele Zwecke reicht ein PDF-Auszug im geeigneten Maßstab (z. B. 1:1000); er ist schnell verfügbar, gut archivierbar und lässt sich mit digitalen Signaturen versehen. Fachanwender benötigen dagegen oft Vektordaten für GIS oder CAD, etwa als Shape, NAS oder DXF. Damit kannst du Grenzen analysieren, Flächen berechnen oder eigene Planungen überlagern.
In den Geoportalen der Länder kannst du meist Maßstab, Ausschnitt und Format wählen. Papierausgaben gibt es von DIN A4 bis A0, digitale Ausgaben als PDF, TIFF oder GIS-/CAD-Formate. Welche Variante du brauchst, hängt von deinem Zweck ab: Für den Grundbuchvollzug reicht oft ein beglaubigter Papierauszug, für Architekten ist ein DXF oder Shape zum Einlesen in Planungssoftware praktischer.
- Typische Maßstäbe: 1:500 (Detail), 1:1000 (Standard im Siedlungsbereich), 1:2000 (Übersicht), 1:2500/1:5000 (weitere Übersicht).
- Digitale Formate: PDF/TIFF (Raster), Shape (SHP) für GIS, NAS (ALKIS-Objektstruktur), DXF (CAD-Austausch).
- Papierformate: DIN A4 bis A0, optional beglaubigt mit Siegel.
- Zweckwahl: PDF für schnelle Nachweise, SHP/NAS für Analysen, DXF für Planungsabgleich.
- Hintergrund: ALKIS ist das einheitliche Datenmodell – Formate sind unterschiedliche „Ansichten“ derselben Daten.
- Druckhinweise: Maßstabsangabe und Maßstabsleiste müssen lesbar sein; bei PDF den Druck ohne „Anpassen“ bzw. skaliert auf 100 % durchführen.
Kosten & Beglaubigung
Die Gebühren sind Ländersache und richten sich nach Maßstab, Format und Art der Ausfertigung. Für einen einfachen Auszug im Standardmaßstab starten die Preise häufig bei etwa 20–30 Euro (zuzüglich USt, falls anwendbar). Größere Formate, umfangreiche Ausschnitte oder mehrere Blattseiten erhöhen die Kosten. Digitale Auszüge (PDF) sind teils günstiger als Papier, aber nicht immer – maßgeblich ist die Gebührenordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Eine Beglaubigung benötigst du, wenn die Karte als amtlicher Nachweis in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren dienen soll – zum Beispiel für Grundbuchangelegenheiten oder spezielle Bauantragsbestandteile. Beglaubigungen kosten zusätzlich, häufig im Bereich von 10–25 Euro pro Dokument oder Blatt. Achte darauf, ob dein Empfänger eine „einfach beglaubigte“ Karte akzeptiert oder eine qualifizierte elektronische Signatur (bei eIDAS-konformen PDFs) verlangt.
Neben der reinen Auszuggebühr können Porto, Versand oder Verwaltungszuschläge anfallen, insbesondere bei Papierausgaben. Bei Online-Bestellungen variieren die Zahlungswege: Kreditkarte, Lastschrift, giropay oder Rechnung. Die Bearbeitungszeiten reichen von sofortigem Download bis zu mehreren Werktagen, insbesondere wenn eine amtliche Beglaubigung per Post verschickt wird.
Beispielkosten Bundesländer
Als grobe Orientierung (ohne Gewähr, bitte aktuelle Landespreise prüfen): In Nordrhein-Westfalen liegen einfache PDF-Auszüge oft um 25 Euro, eine Beglaubigung kann zusätzlich 10–20 Euro kosten. In Bayern bewegen sich Standardauszüge häufig im Bereich von 20–35 Euro, abhängig von Format und Ausschnittgröße. In Niedersachsen beginnen viele Angebote bei etwa 20–30 Euro, während Berlin/Brandenburg für beglaubigte Papierauszüge teils im mittleren zweistelligen Bereich liegen. In Hessen sind digitale Auszüge typischerweise günstiger als großformatige Drucke; Beglaubigungen werden separat berechnet. Diese Beispiele zeigen: Maßstab, Format und Beglaubigung bestimmen den Endpreis stärker als die reine Adresse.
Wo bestellen (Landesportale, Katasteramt, Online‑Shop)
Bestellen kannst du die Liegenschaftskarte über das Geoportal deines Bundeslandes, direkt beim zuständigen Kataster- oder Vermessungsamt oder über kommunale Online-Shops. Viele Länder bieten ein ALKIS-Portal, in dem du Adresse oder Flurstücksnummer eingibst, den Ausschnitt wählst und anschließend Bestellung und Bezahlung online erledigst. Alternativ sind Bestellungen per E-Mail, Fax oder persönlich möglich – dabei gibst du Gemarkung, Flur und Flurstück an oder beschreibst den gewünschten Kartenausschnitt.
- Bestellwege: Landes-Geoportale mit Online-Shop, E-Mail an das Liegenschaftskatasteramt, Fax- oder Postformular, persönliche Vorsprache, Bestellung über Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen/ingenieure (ÖbVI), teils auch über kommunale Bürgerportale.
Die Bereitstellung kann sofort erfolgen (Downloadlink nach Online-Zahlung) oder einige Tage dauern, etwa bei beglaubigten Papierausfertigungen. Grundsätzlich darf jede Person eine Liegenschaftskarte beantragen; für die Weiterverwertung (z. B. kommerzielle Nutzung) können jedoch zusätzliche Genehmigungen oder Lizenzvereinbarungen nötig sein. Prüfe im Geoportal die Nutzungsbedingungen und halte bei Unsicherheit kurz Rücksprache mit dem Katasteramt.
Schritt‑für‑Schritt Online‑Bestellung
Schritt 1: Öffne das Landes‑Geoportal (z. B. über die Website deines Katasteramts) und wechsle in den Kartenviewer für ALKIS.
Schritt 2: Suche nach Adresse, Gemarkung/Flurstück oder nutze die Kartenzoom-Funktion, bis der gewünschte Bereich gut im Bild liegt.
Schritt 3: Wähle den Maßstab passend zum Zweck (typisch 1:1000 im Siedlungsbereich) und kontrolliere die Lesbarkeit der Flurstücksnummern.
Schritt 4: Entscheide dich für Format und Ausgabeart: PDF/TIFF für Raster, SHP/NAS/DXF für GIS/CAD. Prüfe, ob eine Beglaubigung benötigt wird.
Schritt 5: Definiere den Ausschnitt (Druckrahmen) exakt. Viele Portale erlauben das Verschieben und Drehen des Druckrahmens sowie die Wahl von DIN-Formaten.
Schritt 6: Lege die Karte in den Warenkorb und gib deine Kontaktdaten an. Beachte Hinweise zu Gebühren und Lizenztexten.
Schritt 7: Bezahle mit dem angebotenen Verfahren (z. B. Kreditkarte oder giropay) und bestätige die Bestellung.
Schritt 8: Lade die Dateien herunter oder warte auf den Versand per Post, falls du Papier oder Beglaubigung bestellt hast. Prüfe anschließend Datum und Maßstabsleiste.
Nutzungstipps für Käufer, Verkäufer, Bauherren
Wenn du eine Immobilie kaufst, hilft dir die Liegenschaftskarte, Grenzverläufe und Gebäudelage zu verstehen: Liegt der Carport wirklich auf deinem Flurstück? Endet der Zaun exakt auf der Grenze oder steht er leicht versetzt? Solche Fragen erkennst du im Zusammenspiel mit Luftbildern und Grundstücksbesichtigung. Verkäufer nutzen den Auszug, um Exposés aufzuwerten und belastbare Angaben zu Flächen und Grenzen zu unterfüttern.
Für Bauherren ist die Liegenschaftskarte die Basis vieler Planungen. Architektinnen und ÖbVIs erstellen daraus den amtlichen Lageplan, ergänzen Höhen, Abstandsflächen und planungsrechtliche Informationen. Für das Bauamt zählt die korrekte, aktuelle Datenbasis – wenn die Karte veraltet ist, kann eine Gebäudeeinmessung nach Baufertigstellung erforderlich sein. Im Zweifel gilt: Lieber einmal mehr beim Katasteramt nachfragen, als mit falschen Grundlagen zu planen.
Checkliste vor Kauf (Eigrenzen, Baulasten, Nutzungsarten)
- Flurstücksnummern und Grenzen mit der Karte prüfen, Zaunverlauf und sichtbare Grenzzeichen vor Ort vergleichen.
- Grundbuchauszug besorgen: Eigentümer, Dienstbarkeiten (z. B. Wegerechte) und Lasten klären.
- Baulastenverzeichnis einsehen: Gibt es Abstandsflächenübernahmen, Stellplatz- oder Zuwegungspflichten?
- Nutzungsarten und Bebauungsplan prüfen: Passt die geplante Nutzung zum Planungsrecht?
- Luftbilder im Geoportal vergleichen: Sind Anbauten erkennbar, die noch nicht in der Karte sind?
- Aktualitätsdatum des Auszugs kontrollieren: Versionsstand und ggf. Hinweise zur letzten Fortführung.
- Leitungs‑ und Überschwemmungskarten sichten: Liegen Trassen oder Risikozonen im oder am Grundstück?
- Bei Unklarheit zur Grenze: Grenzanzeige oder Vermessung durch ÖbVI erwägen.
Datenschutz & Weiterverwendung
Die Liegenschaftskarte zeigt keine personenbezogenen Eigentümerdaten – diese stehen im Grundbuch. Karteninhalte unterliegen jedoch dem Urheber‑ und Datenbankrecht der Vermessungsverwaltungen. Für private Zwecke darfst du Auszüge in der Regel nutzen, speichern und ausdrucken; bei Veröffentlichung oder kommerzieller Weiterverwendung (z. B. auf Websites, in Broschüren) können Lizenzbedingungen, Nennungspflichten oder Gebühren gelten.
Achte auf den Lizenzvermerk im Geoportal: Manche Länder stellen ALKIS-Auszüge unter offenen Lizenzen (z. B. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung), andere verlangen eine separate Nutzungsvereinbarung. Wenn du Karten an Dritte weitergibst (Makler, Planer, Behörden), prüfe, ob der Zweck gedeckt ist und ob ggf. eine Beglaubigung erforderlich ist. Ein kurzer Blick in die Nutzungsbedingungen spart später Rechte‑ und Gebührenstress.
Wann eine neue Vermessung nötig ist
Eine Liegenschaftskarte ist ein Abbild des Rechtsbestands, aber sie ersetzt nicht jede Vermessung. Brauchst du Rechtssicherheit an der Grenze – etwa weil ein Zaun neu gesetzt, eine Mauer gebaut oder ein Grenzstreit beigelegt werden soll –, ist eine Grenzanzeige oder Grenzfeststellung durch einen ÖbVI sinnvoll. Bei Teilungen (Abverkauf von Teilflächen) ist eine Teilungsvermessung vorgeschrieben, damit das Kataster angepasst und das Grundbuch richtig fortgeführt wird.
In einigen Bundesländern gilt eine Gebäudeeinmessungspflicht: Nach Fertigstellung eines Neubaus müssen dessen Umrisse vermessen und ins ALKIS übernommen werden. Für Bauanträge benötigst du häufig einen amtlichen Lageplan statt nur einer Liegenschaftskarte; dieser Plan enthält mehr Informationen und ist auf das Vorhaben maßgeschneidert. Als erster Beleg reicht der Kartenabzug oft, aber überall dort, wo Zentimeter zählen, führt kein Weg an der Vermessung vorbei.
Extra‑Tipp: Aktualitätscheck per Luftbild
Prüfe vor Bestellung oder Nutzung immer die Aktualität. Im Landes‑Geoportal kannst du meist ALKIS mit aktuellen Luft‑/Orthofotos überlagern und den Zeitstempel der Bildbefliegung anzeigen. Siehst du auf dem Luftbild einen Anbau, der im ALKIS‑Gebäudeumriss fehlt, ist die Karte vermutlich noch nicht fortgeführt. Das ist normal – die Fortführung folgt auf Einmessung und Prüfung.
Nutze den Vergleich mehrerer Luftbildjahrgänge: So erkennst du, ob Veränderungen zwischen zwei Ständen liegen. Ergänze den Blick mit Street‑View‑ähnlichen Diensten (wenn verfügbar) und dem Bebauungsplan. Wenn es auf Tagesaktualität ankommt, frage beim Katasteramt nach dem letzten Fortführungsdatum oder beauftrage die Gebäudeeinmessung, damit die ALKIS‑Daten zeitnah nachgezogen werden.
Extra‑Tipp: QGIS‑Kurzworkflow zum eigenen Auszug
Schritt 1: Starte QGIS und richte das Projekt in ETRS89/UTM ein, passend zur UTM‑Zone deines Landes (die Geoportale nennen oft die Koordinatenreferenz).
Schritt 2: Lade die Daten: Für Shape (SHP) geh auf „Datenquelle hinzufügen“ und wähle die SHP‑Layer (Flurstücke, Gebäude, Nutzungen). Für NAS nutze das QGIS‑Plugin „NAS‑Importer“ oder eine Konvertierung (z. B. über ogr2ogr) in GML/SHP.
Schritt 3: Style die Layer: Grenzen als kräftige Linien, Flurstücksflächen transparent mit feiner Kontur, Gebäude in einer dezenten Füllfarbe. Flurstücksnummern als Beschriftung aus dem Attribut (z. B. flstnr).
Schritt 4: Messe Flächen/Längen: Aktiviere das Messwerkzeug in QGIS, wähle das passende CRS und erhalte präzise Werte für Grundflächen und Grenzabschnitte.
Schritt 5: Ergänze Hintergrund: Falls lizenziert, binde ein WMS‑Luftbild oder die ALKIS‑Webkarte des Geoportals ein. Achte auf Nutzungsrechte und Quellenangabe im Drucklayout.
Schritt 6: Erstelle ein Drucklayout: Öffne den Layout‑Manager, setze Kartenrahmen, Nordpfeil, Maßstabsleiste und einen Titel. Füge Datum, Quellen‑/Lizenzhinweise (z. B. © Land XY, ALKIS) ein.
Schritt 7: Skaliere korrekt: Setze den Maßstab auf 1:1000 oder 1:2000 und kontrolliere, ob die Beschriftung lesbar bleibt. Vermeide automatische Druckskalierung im PDF‑Export.
Schritt 8: Exportiere als PDF oder TIFF: Lege die DPI‑Auflösung fest (z. B. 300 dpi) und prüfe den Export. Für interne Zwecke ist das top; für amtliche Nachweise brauchst du weiterhin einen offiziellen Auszug bzw. eine Beglaubigung.
Schritt 9: Archiviere sauber: Benenne Dateien mit Datum, Gemarkung und Flurstück. Hinterlege das CRS im Dokument und notiere die Lizenzbedingungen für spätere Nutzung.
Schritt 10: Optional analysieren: Puffer um Grenzen (z. B. 3 m Abstandsflächen) bilden, Flächensummen bilden oder Schnittmengen mit Überschwemmungszonen berechnen – QGIS spielt hier seine Stärken aus.
Mit diesem Workflow wird aus einem Datendownload ein brauchbarer Plan – schnell, reproduzierbar und zweckorientiert. Achte nur darauf, dass eine QGIS‑Ausgabe keinen amtlich beglaubigten Auszug ersetzt; sie ist ein hervorragendes Arbeitsmittel, aber kein amtlicher Nachweis.