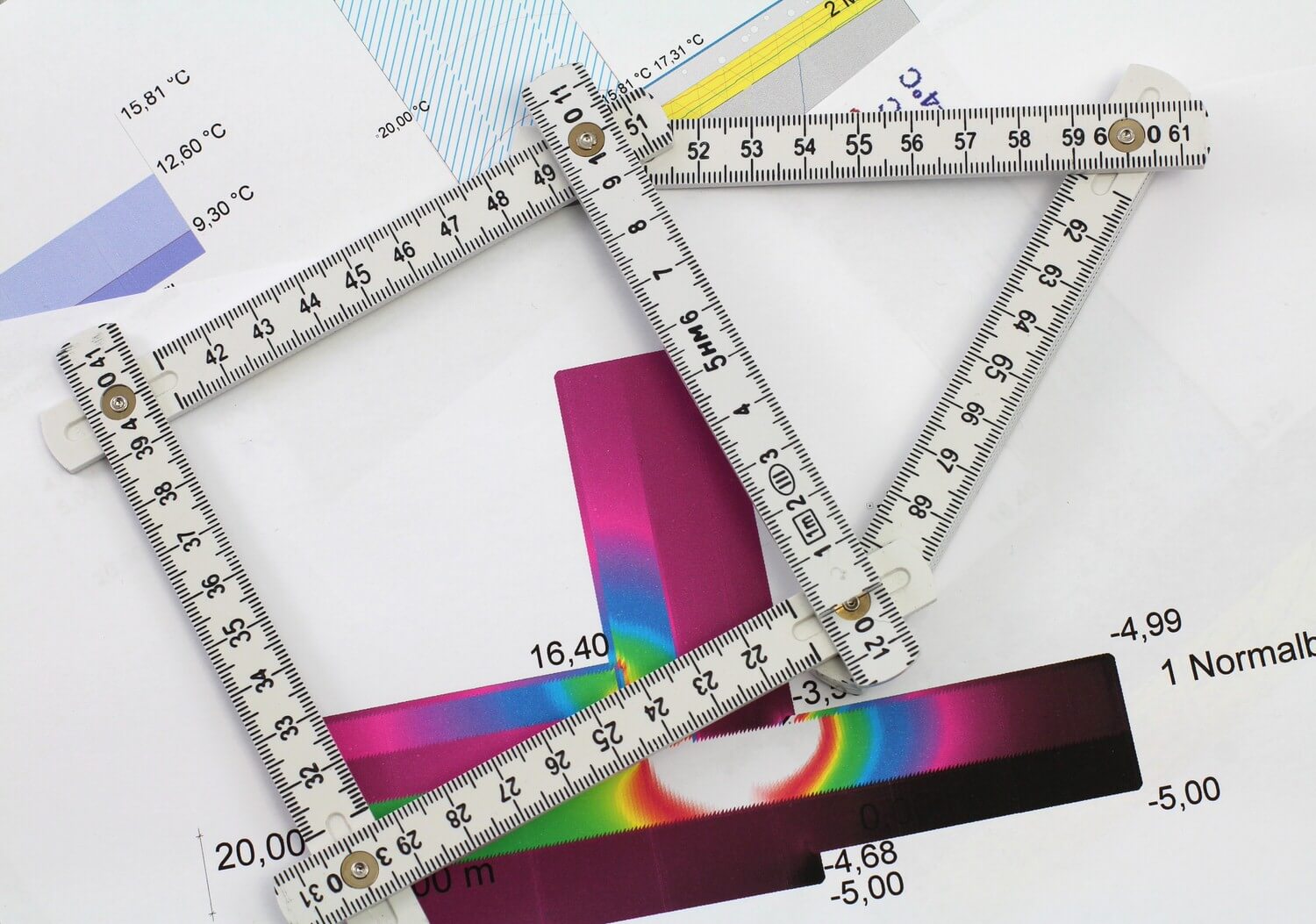Was muss ich bei Solarstrom beachten?
Solarstrom, das ist die umweltfreundliche sowie dank gezielter staatlicher Förderung überaus lohnenswerte Alternative für Eigenheimbesitzer, ihr Haus zugleich als Anlageform zu nutzen. Der Staat garantiert hier für Photovoltaikanlagen eine maximale Einspeisevergütung, sodass bei baulicher Eignung der Immobilie Chancen aufgetan werden, Energiekosten selbst zu verringern und zudem durch die überschüssige Abgabe einen finanziellen Gewinn daraus zu…